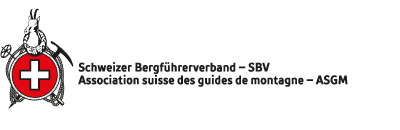«Die Berge lehren uns viel»
Martina Hunziker, 10.07.2024, Bund; Fotos: Raphael Moser

Zum Job gehöre es auch, jemanden von seinem Traumgipfel abzubringen, sagen Laura Bomio und Peter Schmid.
Vom Gipfelglück: Peter Schmid ist seit 47 Jahren Bergführer. Laura Bomio seit 2018. Ein Gespräch zwischen den Generationen über das Glück in den Bergen und die Freude am Unplanbaren.
15 «Gewaltig, nicht?», sagt Peter Schmid und bleibt andächtig stehen. Um uns herum sind Enziane, Bergveilchen, Wundklee und Trollblumen in voller Blüte. Es ist ein Bergfrühlingstag wie im Bilderbuch. Vor uns breitet sich die saftig grüne Ebene der Engstligenalp aus, der Wildstrubel erhebt sich majestätisch vor wolkenlosem Himmel. «Was haben wir für ein Glück!», freut sich Schmid.
Peter Schmid kennt diesen Ort so gut wie seine eigene Westentasche. Der gebürtige Adelbodner ist diesen Sommer in seiner 47. Saison als Bergführer unterwegs. Seine Liste von erklommenen Bergen, die über 4000 Meter hoch sind, zählt weit über 400 Einträge. Und immer noch ist der 68-Jährige beglückt, wenn er den Blick über die ihm so altbekannten Bergkämme seiner Heimat schweifen lässt.
Laura Bomios Berge befinden sich ein paar Täler weiter – das Schreckhorn, der Mönch oder das Grosse Grünhorn etwa. Bomio ist Grindelwalderin. Die gelernte Pflegefachfrau verbrachte mehrere Winter als Skilehrerin auf der Piste und die Sommer in Saisonjobs, bevor sie 2020 schliesslich die Ausbildung zur Bergführerin abschloss. Heute arbeitet die 40-jährige Vollzeit als Bergführerin. Auch sie ist mit dabei auf diesem Spaziergang durch blühende Alpwiesen, um über das Glück der Berge zu reden.

Ein Bergfrühlingstag wie im Bilderbuch, im Hintergrund der Wildstrubel. Der Blick in die Weite wirkt stressreduzierend und macht glücklich – das besagen auch Studien.
Ehrfurcht als Therapie
Schmid und Bomio sagen beide, dass sie diesen Job machen, weil die Berge nach ihnen gerufen haben. Sie sind sich einig: Dem Glücksgefühl auf einem Gipfel kann man sich nicht entziehen. «Wenn du oben ankommst und den Blick in die Weite hast – das berührt dich jedes Mal bis ganz tief hinein», sagt Bomio.
Damit spricht die Bergführerin etwas an, was auch wissenschaftlich belegt ist. In einer 2020 veröffentlichten Studie etwa wies ein Forschungsteam der University of California, Berkeley, nach, dass sich das Erleben von Natur positiv auf die Psyche auswirkt. Das Team um den Psychologieprofessor Dacher Keltner beschreibt in der Studie die heilende Wirkung von «Awe walks», was sinngemäss übersetzt «Ehrfurcht-Spaziergänge » bedeutet.
Die Emotion Ehrfurcht («Awe»), verspürt man gemäss den Forschenden beim Anblick von etwas, das viel grösser ist als man selbst: das Panorama auf einem Berggipfel oder der Weitblick über das Meer etwa. Das wirke, wie in der Studie steht, stressreduzierend, fördere die soziale Bindung und könne – kurz – glücklich machen.
«4000er sind sehr beliebt»
Es ist der Job von Bomio und Schmid, ihren Gästen zu diesem Gipfelmoment zu verhelfen. Weitsicht, vielmehr im Sinne von Vorausplanen, ist da zentral. «Die Berge lehren uns viel. Wir müssen sie nehmen, wie sie sind. Wenn wir das tun, geben sie uns viel zurück», so Peter Schmid. Das bedeute manchmal auch, sich aus Sicherheitsgründen den Plänen der Gäste zu widersetzen.
«Die 4000er sind sehr beliebt », sagt Bomio. Viele Gäste hätten einen ganz bestimmten Gipfel im Kopf. «Wenn aber die Voraussetzungen nicht zusammenpassen, muss man auch mal jemanden von seinem Traumgipfel abbringen.»
Bomio erzählt, dass sie einen Gast auf das Grosse Grünhorn führte, der eigentlich unbedingt auf das Finsteraarhorn gewollt hätte. Erst als sie den Gipfel für sich allein hatten und zum anderen Berg rübersahen, wo sich die Berggängerinnen und -gänger schier auf den Zehen herumstanden, war es um den Gast geschehen. «Er hat sich noch Tage später für das unvergessliche Erlebnis bedankt.»
3 Prozent Frauen
Laura Bomio und Peter Schmid sind 2 von zurzeit 1580 registrierten Schweizer Bergführerinnen und Bergführern. Das seien grundsätzlich genug, um die Nachfrage zu decken, erklärt Pierre Mathey, Geschäftsführer des Schweizerischen Bergführerverbands (SBV), in einem Telefongespräch. «Einzig in den Sommermonaten kommt es während ein paar Wochen manchmal zu Engpässen.»
Zurzeit werden jährlich 25 bis 30 neue Bergführerinnen und -führer diplomiert. Die Nachfrage nach der Ausbildung hat gemäss Mathey in den letzten Jahren zugenommen. Wo der SBV aber noch deutlichen Aufholbedarf hat, ist bei der Frauenquote: Nur 3 Prozent der Verbandsmitglieder sind Bergführerinnen.
Warum das Interesse von Frauen am Job als Bergführerin nicht grösser ist, sei eine Frage, der der SBV intensiv nachgehe, so Mathey. Ein wesentlicher Punkt sei sicher die Schwierigkeit, den Beruf mit dem Privatleben zu vereinbaren. «Und vielleicht auch, den Mut zu haben, sich für diesen Risikoberuf zu entscheiden.»
Grosse Entbehrungen
Das sagen auch Schmid und Bomio, während wir unseren Spaziergang fortführen. «Wer diesen Job nicht aus Leidenschaft macht, bleibt nicht lange dabei», sagt Schmid. Zu viele Entbehrungen bringt er mit sich: Man ist viel unterwegs, hat unregelmässige Arbeitszeiten, schläft kaum im eigenen Bett.
Beziehung und Familie – das geht nur mit jemandem an der Seite, der oder die bereit ist, die langen Abwesenheiten in Kauf zu nehmen. Schmid erzählt, dass seine Frau immer gesagt habe, sie mache mit, solange die drei Kinder nicht fragen, wer er sei, wenn er von seinen Touren nach Hause komme. Er lacht. «Sie erwarteten mich immer mit ausgestreckten Armen.»
Als Selbstständige machen Schmid und Bomio ihre Planung selbst. Das habe Vorteile, sei aber auch anspruchsvoll, sagt Bomio. Sie musste zuerst lernen, bewusst Freiräume für sich einzuplanen, um die stete Anspannung der Touren loslassen zu können. «In unserem Beruf ist es enorm wichtig, dass man gut auf sich selber achtet. Sonst bist du irgendwann nicht mehr glücklich bei dem, was du machst.»
Tränen auf dem Gipfel
Ihre persönlichen Glücksmomente findet Laura Bomio während Touren auch im Unplanbaren: «Ich freue mich immer, wenn ich am Morgen mit meinem Gast allein loslaufe und am Abend in der SAC-Hütte unverhofft auf Menschen treffe, die ich kenne.»
Dasselbe sagt auch Peter Schmid. Er lebe von den Begegnungen, der Kollegialität unter Bergführerinnen und Bergführern. Und von der Dankbarkeit der Gäste. «Die ist mindestens so wichtig wie der Lohn, der nach einer Tour auf unserem Konto eingeht.»
Dann erzählt er von einer Tour aufs Matterhorn, auf der er einen Skilehrerkollegen begleiten durfte. «Das Team schenkte ihm die Tour und sammelte Geld dafür, auch ich gab ein Nötli in den Topf. Erst später erfuhr ich, dass ich die Tour führen darf», so der Bergführer. Die Verhältnisse seien perfekt gewesen, am Berg wenig los. Den Gipfel hatten sie für eine Viertelstunde ganz für sich allein. «Meinem Kollegen liefen die Tränen nur so herunter», so Schmid.
«Die Berge verändern sich»
Mittlerweile sitzen wir beim Kaffee in der Bergbeiz. Schmid erzählt, dass er in den 1970er-Jahren oftmals eine ganze Woche fix hier im Berghaus stationiert gewesen sei, um täglich neue Gäste auf den Wildstrubel zu begleiten. Heute begeht er den Berg im Sommer kaum mehr. Zu stark ausgeapert ist der Weg, zu gross die Gefahr von Steinschlag.
Wir blicken hinauf zum schneebedeckten Gipfel. Der Wildstrubel ist nur einer von vielen Bergen, die sich mit dem Klimawandel stark verändert haben. Bedauern darüber ist in Schmids Erzählungen jedoch keines zu spüren. Und auch Bomio, die hofft, noch viele Jahre als Bergführerin unterwegs zu sein, sieht dies pragmatisch.
«Die Berge verändern sich, und damit auch unser Beruf. Das ist unter anderem auch das Spannende daran», sagt Laura Bomio. Peter Schmid nickt. Die beiden nehmen die Berge, wie sie sind. Und finden dort wohl gerade deshalb jeden Tag wieder von Neuem das Glück.