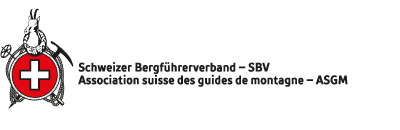«Die Fehleinschätzung der eigenen Fähigkeiten ist die grösste Gefahr»

In ihrem Beruf liegt der Frauenanteil nur bei 3 Prozent: Rita Christen (58) aus Disentis GR ist als Bergführerin in einer krassen Minderheit.
Rita Christen hat mehrere ihr nahestehende Menschen in den Bergen verloren. Dennoch gehe sie privat Risiken ein, sagt die Präsidentin des Bergführerverbands, «weil ich das Bergsteigen so liebe».
Rita Christen aus Disentis GR ist seit 2021 die erste Frau an der Spitze des Schweizer Bergführerverbandes (SBV). Von 2011 bis 2023 leitete sie die Fachgruppe Expertisen bei Bergunfällen. Die 58-jährige hauptberufliche Juristin ist auch selbst als Bergführerin und Bergretterin im Einsatz. Mehr als drei Tage hält es die Bündnerin nicht ohne Aktivität am Berg aus.
Frau Christen, vor zwei Wochen starben fünf Berggänger am Rimpfischhorn im Wallis. Sie wollten sich zunächst nicht dazu äussern.
Zum Unfall selbst hätte ich keine Auskunft geben können, ich kenne weder die Route noch die Umstände. Und Fragen zu Bergunfällen allgemein wollte ich erst einmal nicht beantworten, weil mir dies pietätlos erschien.
Sie selbst haben auch schon Freunde und Freundinnen in den Bergen verloren?
Ja, mehrere mir liebe Menschen starben beim Bergsteigen, und mein Ehemann hat vor rund zehn Jahren einen Unfall nur knapp überlebt. Trotzdem gehe ich für mich als private Bergsteigerin in einem vernünftigen Rahmen noch immer ziemlich unbeschwert Risiken ein. Einfach weil ich das Bergsteigen so liebe.
Sie sind auch Bergführerin. Wie handhaben Sie in dieser Rolle den Umgang mit dem Risiko?
Als Bergführerin trage ich schwer an der Verantwortung für meine Gäste und bin defensiver unterwegs. Schwierig macht es die Tatsache, dass bei gewissen Risiken – insbesondere bei der Lawinengefahr – immer eine Unsicherheit bleibt. Deshalb informiere ich meine Gäste stets über das verbleibende Restrisiko einer Tour, vergleichbar mit der ärztlichen Aufklärung vor einem chirurgischen Eingriff.
Der Bergsport boomt, verzeichnet man auch Rekordzahlen bei den Notfällen am Berg?
Nein, im Gegenteil. Aus der Bergnotfallstatistik des SAC geht hervor, dass die Zahl der Bergnotfälle nicht im selben Ausmass ansteigt wie die Anzahl der Bergsteiger und Bergwanderer. Zum Teil zeigt die Statistik sogar einen Rückgang der Unfälle. Man kann also sagen, dass Bergsteigen im Lauf der Zeit sicherer geworden ist. Das leuchtet ein.
Warum?
Die Kenntnisse über die alpinen Gefahren werden laufend verfeinert, das Material wird stetig verbessert, und die meisten Menschen wählen Aktivitäten, denen sie technisch gewachsen sind. Oder sie lassen sich von einer qualifizierten Fachperson führen.
Wo liegt das grösste Gefahrenpotenzial in den Bergen?
Gemäss der Bergnotfallstatistik verunfallen mit Abstand am meisten Menschen beim Wandern in den Bergen. Das erstaunt vielleicht, zeigt aber auf, dass die grösste Gefahr wahrscheinlich die Fehleinschätzung der eigenen Fähigkeiten ist.
Was sind die Folgen daraus?
Die häufigste Ursache von Bergnotfällen sind Sturz und Absturz. Darauf folgt Blockierung/ Erschöpfung, dann Erkrankung, Verirren, Lawinen, Stein- und Eisschlag, Spalteneinbruch und zuletzt, ganz selten, Blitzschlag.
Sind es mehr Schweizer oder mehr Ausländer, die in den Bergen verunfallen?
2024 verunfallten annähernd gleich viele Schweizer wie Ausländer. 2023 waren deutlich mehr Ausländer betroffen, und 2021 gab es wesentlich mehr schwere Unfälle von Schweizern. Für mich ist da kein Muster erkennbar. In Bezug aufs Geschlecht ist es hingegen eindeutig: Die Unfallzahlen liegen bei den Männern seit je deutlich höher als bei den Frauen.
Haben Sie eine Erklärung?
In verschiedenen Bergsportdisziplinen – wie zum Beispiel Eisklettern und Skihochtouren – sind noch immer deutlich weniger Frauen unterwegs. Zudem sind Frauen allem Anschein nach generell etwas defensiver im Umgang mit Risiken. Bei den Bergführern liegt die Frauenquote noch immer unter 3 Prozent. Derzeit sind wir 44 Bergführerinnen und rund 1500 Bergführer.
Welche Rolle spielt das Wetter?
Das Wetter ist offensichtlich zentral beim Bergsport, und es hilft uns sehr, dass wir uns bei der Planung auf gute Prognosen von verschiedenen Wetterdiensten abstützen können. Je nach Wetterlage sind die Prognosen aber mehr oder weniger verlässlich. Dies muss man bei der Planung einer Aktivität in den Bergen berücksichtigen – und stets einen Plan B haben, wenn das Wetter auf die schlechtere Seite kippt.
Die Orientierung kann in den Bergen schwierig sein. Wie gehen Sie damit um?
Ich führe aus ökologischen Gründen ausschliesslich Touren in der Schweiz. Hier stehen mir auch topografische Karten in höchster Qualität zur Verfügung. In Verbindung mit einem GPS ist die Orientierung so auch bei schwierigen Sichtverhältnissen stets gewährleistet.
Die Ausrüstung wird immer billiger – hat das auch Folgen für die Sicherheit?
Im Hinblick auf die Sicherheit ist der Preis nicht entscheidend. Zentral ist die Zertifizierung nach den einschlägigen Standards. Als ich mit Bergsteigen anfing, war ab und zu noch billiges, nicht zertifiziertes Material im Umlauf. Ich erinnere mich gut an dubiose Eisschrauben aus Russland. Solche Probleme kennt man in der Schweiz schon lange nicht mehr.
Manche Touristen marschieren auch bei prekären Bedingungen los, weil sie nur wenige Tage in den Bergen sind. Welche Rolle spielt der Zeitdruck?
Das kann ich nicht beurteilen. Meine Gäste lassen sich stets ohne Probleme von einem Alternativprogramm überzeugen, wenn die Verhältnisse für die geplante Tour nicht passen.
Sollte man grundsätzlich mit einem Führer in unbekanntem Gebiet unterwegs sein?
Nein, so pauschal kann man das nicht sagen. Erfahrene und gut ausgebildete Bergsteiger können auch in unbekanntem Gebiet mit angemessenem Risiko selbstständig unterwegs sein. Einen Bergführer, Kletterlehrer oder Wanderleiter sollte man für Touren beiziehen, denen man selber alpintechnisch nicht gewachsen ist. Und natürlich sollte man sich von Fachpersonen ausbilden lassen, bevor man selbstständig Bergtouren macht.
Was kostet denn ein Bergführer für eine Tagestour?
Das variiert sehr stark je nach der Schwierigkeit der Aktivität. Der Richttarif des SBV liegt für einen Bergführer bei 650 Franken pro Tag.
Durch den Klimawandel sind manche Routen nicht mehr begehbar, weil ganze Hänge instabil werden. Wie gehen Sie mit diesen neuen Gefahren um?
In den Bergen erlebe ich die Folgen des Klimawandels direkt und augenscheinlich. Das beunruhigt und beelendet mich zutiefst, ich bin ja Teil der Konsumgesellschaft, die das verursacht. Für mich als Bergführerin hingegen stellen die Klimawandelfolgen einfach eine weitere Herausforderung dar, und ich vertraue darauf, dass wir Bergführer und Bergsteiger es schaffen, uns stets an die sich verändernden Umstände anzupassen.
_
Chris Winteler, Tagesanzeiger, 11.04.2025
Foto: Nicola Pilaro